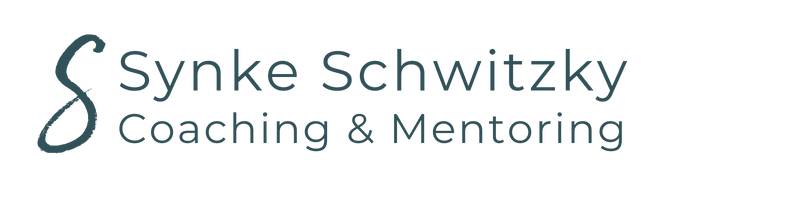In meinem Leben schaue ich nach vorne. In meiner etwas älteren Vergangenheit hieß dies – noch ganz unbewusst – groß zu werden. Selbst zu entscheiden, was ich anziehe, esse, in meiner Freizeit mache. Der Weg in die Selbstständigkeit. Von klein ...
Gehörst du auch zu den Menschen, die meinen, dass man die Vergangenheit besser nicht anrührt? Du sagst, vorbei ist vorbei? Für mich steckt darin nur die halbe Wahrheit. Für mich steckt in der Vergangenheit ein, nun ja, zumindest kleiner Schatz. ...
Ich habe Pläne. Pläne, die es erforderlich machen, über mich selbst nachzudenken. Sie kennen mich nicht anders. Ich mache das gerne. Das hat auch einen entscheidenden Vorteil: Ich weiß, wer ich bin. Ich kenne meine Stärken und Talente, sodass ich ...
Veränderung ist nicht einfach. Sie ist unbequem. Sie sticht, brennt und lässt auch mal die Tränen fließen. Das habe ich letzte Woche gespürt. Eine neue Situation hat mich in alte Themen blicken lassen, auf die ich offenbar lediglich ein Pflaster ...
Ich bin ein Kopfmensch, und darauf bin ich stolz. Mein Kopf hat mich schon viele Entscheidungen treffen lassen, die gut für mich waren. So hat mich meine “Denkmaschine” beispielsweise davor bewahrt, mich beispielsweise auf unnötige (Frust-) Käufe, Energie saugende Jobs ...
Marc Aurel hat mal gesagt: „Das Glück im Leben hängt von den guten Gedanken ab, die man hat.“ Gute Gedanken versorgen uns mit positiven Gefühlen. Gedanken sind also mächtig. Das gilt für positive wie eben auch für negative Gedanken. Deine ...
Am vergangenen Wochenende kam ich in einem Gespräch an dem Thema Perfektionismus vorbei. Da ich selbst nicht ganz frei davon bin, hörte ich mich an der einen oder anderen Stelle sagen: „Das hat was mit meinem Perfektionsstreben zu tun.“ Ein ...
Eines meiner ersten Sachbücher war "Gute Mädchen kommen in den Himmel, böse überall hin" von Ute Ehrhardt. Das Buch erschien im Jahr 2000, und ich stelle fest, von böse bin ich weit entfernt. Überall hingekommen bin ich jedoch bisher, in ...
Gestern hat mich ein Frage aus früheren Erfahrungen eingeholt. Ich ärgerte mich gerade lauthals über unseren Geschirrspüler, der nicht wollte, wie ich wollte. Der einfach die Zusammenarbeit verweigerte. Egal, was ich tat, ich fand die Ursache nicht. Ich meckerte und ...
Empathie ist in aller Munde. Viele Unternehmen setzen auf sie bei der Auswahl neuer Mitarbeiter:innen. Singles wünschen sich sich eine:n empathische:n Partner:in. Es gibt heute unzählige Zeitschriften, Bücher und Podcasts, in denen Empathie ihren Platz findet. Empathie, so heißt es, ...
Nach einer kleinen Auszeit bin ich gestern wieder remote in den Job eingestiegen. Heute Morgen traf ich eine Nachbarin, die mich fragte, ob ich zumindest zur Begrüßung einen Willkommensgruß erhalten habe. Ich verneinte – und stutzte. Erst knapp 24 Stunden ...
Wie oft hören wir in diesen Tagen von anderen Menschen, wie sie uns ein frohes und gesundes neues Jahr wünschen. Ich begegne Nachbarn, der Kassiererin im Supermarkt, Freund:innen, der Familie… Alle wünschen mir nur das Beste, eben Frohsinn respektive Glück ...
Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages link='0']