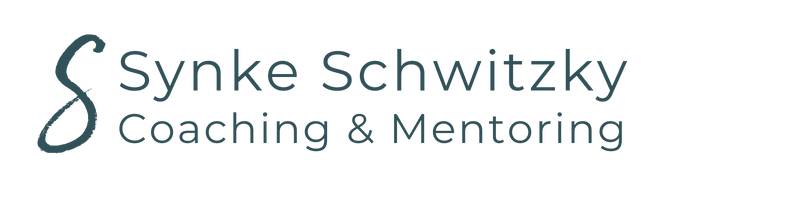Vertrauen ist eine große Sache. Je nachdem, was wir in unserem Rucksack an Erfahrungen mit uns herumtragen, kann es lange dauern, Vertrauen aufzubauen, vor allem nach einer Enttäuschung. Dagegen reicht manchmal nur ein Wimpernschlag, Vertrauen in Misstrauen zu verwandeln. Ein ...
Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages link='0']